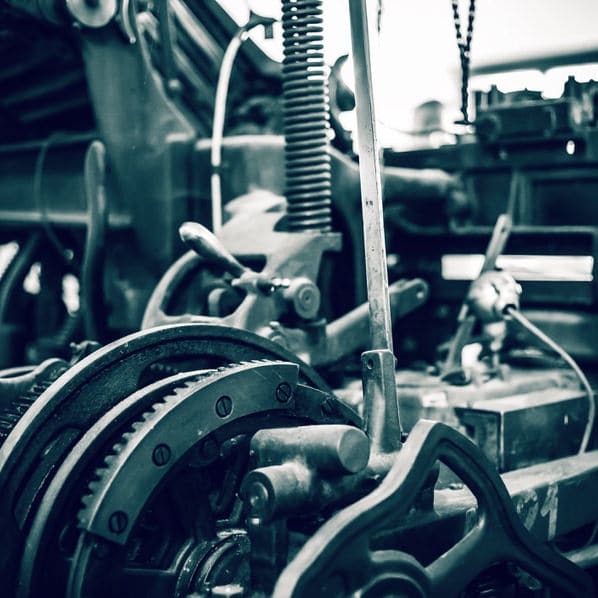Sicher ist, dass die Höhlenzeichnungen, die mit Farbe benetzten Fingern gemalt wurden, schon eine Art von Druckerzeugnis sind, aber als echtes Ergebnis keine Reproduzierbarkeit lieferten. Selbst Mönche, die im frühen Mittelalter, teils jahrelang damit beschäftigt waren, meist sakrale Bücher abzuschreiben, waren nicht gänzlich fehlerfrei.
Ägypten machte dann den Anfang
Um circa 1300 v. Chr. begannen die Ägypter damit, wichtige Verordnungen und Gesetze mit einer reproduzierbaren Methode zu unterzeichnen. Dafür entwickelten sie das Rollsiegel. Im britischen Museum in London, mit seiner großen ägyptischen Abteilung, in vielen anderen Museen auf der Erde und auch im Folkwang Museum Essen, kann man diese Rollsiegel bestaunen. Ein Rollsiegel ist ein zylinderförmiger Körper, der hohl ist. Auf dem äußeren Rand werden die zu druckenden Symbole eingraviert. Beim Siegeln wird der Zylinder einmal mit seinem vollen Umfang, nachdem er in Farbe getaucht wurde, auf das zu unterzeichnende Dokument abgerollt. So erscheinen die erhöhten Bestandteile des Siegels auf der Fläche. Die meistens aus Marmor oder Ton hergestellten Rollsiegel, die nur 4 bis 6 cm lang waren, können so als die ersten echten kleinen Drucker angesehen werden. Im Römischen Reich und im Griechenland der Antike wurden Siegelringe dafür eingesetzt, Dokumente zu bedrucken. Diese bestanden meist aus Bronze und manchmal sogar aus Gold.
Der Holzdruck
Im 7. Jahrhundert setzte sich in Asien der Holzdruck durch. Dabei werden Zeichen spiegelverkehrt in einen Holzblock geritzt, der, in Farbe getaucht, auf das zu bedruckende Material gedrückt wurde. Noch heute werden in Asien Stoffe mit dem gleichen Verfahren bedruckt. Dass Handbedrucktes nicht aus der Mode kommt, beweist die französische Tapetenfabrik Zuber & Cie. Sie produzieren handbedruckte Tapeten bereits seit 1798 sehr erfolgreich.
Der Holzschnitt
Der Holzschnitt, der ebenfalls zu dem Hochdruckverfahren gezählt werden kann, wurde in Europa seit dem 1400 Jahrhundert bekannt. Dabei werden aus einer Holztafel Text- oder Bilddarstellungen ausgeschnitten und anschließend auf das Medium Papier gedruckt. Wer den Holzschnitt das Rhinocerus kennt, hergestellt von Albrecht Dürer im Jahr 1515, wird erkennen, wie akkurat und präzise der Werkstoff eine Bearbeitung zulässt. Mit dem Verkauf seiner Bilder auf Märkten durch seine Frau Agnes wurde er sehr reich. Historiker haben berechnet, dass Dürer nach heutigen Maßstäben mehrfacher Millionär wäre. Er war nicht nur hervorragend, sondern auch sehr erfolgreich. Verschenkt hat er seine Bilder und Drucke nie. Für normal große Werke verlangte er umgerechnet einen fünfstelligen Eurobetrag, für ganz große Gemälde kam noch eine Null dazu.
Der Kupferstich
Der Kupferstich ist ein grafisches Tiefdruckverfahren. Beim Kupferstich wird das zu druckende Bild mit einem Grabstichel spanabhebend in eine Kupferplatte -gegraben. Die dabei entstandenen Linien nehmen dann die Farbe auf, die mit einer Walzenpresse auf das Papier gedruckt wird. Zahlreiche Künstler des 15. und 16. Jahrhunderts fertigten Kupferstiche an, denn mit ihnen konnte man höhere Auflagen erreichen, als es der Holzschnitt erlaubt. Einer der bedeutendsten Kupferstecher des 15. Jahrhunderts war Martin Schongauer. Bei ihm wollte sogar der junge Albrecht Dürer in die Lehre gehen. Nach einem Kupferstich von ihm hat Michelangelo das Bild – Die Versuchung des heiligen Antonius – gemalt und das im Alter von 12 oder 13 Jahren. Das Bild ist im Kimbell Art Museum in Fort Worth, USA ausgestellt. Übrigens: Die Anrede: -Mein alter Freund und Kupferstecher- ist schon sehr alt. Es hat seine Wurzel darin, dass man den Kupferstechern nach Aufkommen des Papiergeldes die nötigen Fähigkeiten zusprach, als Geldfälscher tätig zu werden.
Der Buchdruck
Als Johannes Gutenberg im Jahr 1450 den Buchdruck erfand, war anschließend die Ordnung der Welt eine andere. Ab sofort konnte, wer lesen konnte, günstig an Büchern herankommen, die, vor der Zeit von Gutenberg, nur einer kleinen, meist klerikalen Schicht vorbehalten war. Dazu kam noch, dass die durch Abschrift entstanden Werke meistens in einer Sprache abgefasst waren, die nicht die Sprache der Straße war.
Gutenberg entwickelte metallene Buchstaben, die spiegelverkehrt in einen Setzrahmen gesteckt wurden und Zeile um Zeile eine Seite ergaben. Die Vorteile der Drucktechnik liegen auf der Hand. Damit war eine beliebige Auflagenhöhe und Stückzahl möglich und ein weiterer Vorteil bestand in der Wiederverwertung der einzelnen Buchstaben in jeder beliebigen Anordnung. Das war bis zu dieser Erfindung nie der Fall gewesen, denn Holz verliert mit jedem Druck ein Stück seiner Abbildungsfähigkeit.
Der Offsetdruck
Der Offsetdruck ist ein Druckverfahren mit einer langen Tradition. Das Verfahren entwickelte sich aus dem Steindruck, der bereits im Jahr 1796 erfunden wurde. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei einem Offsetdruck um ein indirektes Verfahren. Indirekt ist das Verfahren deshalb, weil der Druckträger nicht mit der Druckplatte in Berührung kommt. Der Druck läuft über einen Gummituchzylinder, der mit Wasser befeuchtet wird. Die Druckform selbst besteht aus zwei Seiten. Eine Seite muss dauerhaft trocken gehalten werden, da sie die Farbe für den Druck enthält. Die andere Seite wird dauerhaft befeuchtet. Im Offsetdruck gibt es eigene Druckplatten für jede einzelne Grundfarbe. Grund dafür ist, dass die Farben für die Herstellung der verschiedenen abweichenden Nuancen aufgespaltet werden müssen.
Der Farbdruck
Am Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Vier-Farbdruck entwickelt, wobei jede einzelne Farbe aus drei Grundtönen besteht und der Farbe Schwarz. Durch das richtige Mischungsverhältnis kann jede beliebige Farbe erzeugt werden. Die vier Farben, die man dazu braucht sind Rot, Gelb, Blau und Schwarz. Erkennbar ist dieses Verfahren auch noch bei heutigen Druckern, die mit dem CMYK-Farbmodell arbeiten und mit den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz bestückt werden müssen.
Das Trockenkopier-Verfahren
In den 50er Jahren kam ein Gerät der Firma Xerox auf den Markt. Das auch als Xerografie bekannte Druckverfahren basiert auf der Elektrofotografie und dient der Trockenkopie. Einige Merkmale dieses Verfahrens befinden sich auch noch heute in Kopierern und Laserdruckern
Das 20. Jahrhundert
Das 20. Jahrhundert brachte enorme Fortschritte in Sachen Druckerentwicklungen hervor. Bereits im Jahr 1907 wurde der erste fotomechanische Kopierer entwickelt. Im den 1930er Jahren wurde schon mit lichtempfindlichem Papier und der fotografischen Übertragung experimentiert. 1941 entwickelte IBM die verbraucherfreundliche Schreibmaschine mit Proportionalschrift. 1957 war es wiederum IBM, die den ersten Matrixdrucker zur Marktreife führten. Die Buchstaben bestanden nicht mehr aus fertigen Elementen, sondern wurden mit feinen Nadeln aufs Papier gedruckt. Die ersten Matrixdrucker hatten für die Erzeugung eines Buchstabens nur 8 Nadeln zur Verfügung. Aber bei Buchstaben mit Unterlange, wie das kleine g, stießen sie fast an ihre Grenzen. Moderne Nadeldrucker, die heute zum Einsatz kommen, besitzen 24 Nadeln. Dadurch wurde das Schriftbild wesentlich klarer und deutlicher.
Mitte der 60er-Jahre war die Kugelkopfschreibmaschine der Favorit jeder Sekretärin, denn sie war geräuscharm und sehr schnell. Die später entwickelten elektronischen Schreibmaschinen boten viele Vorteile. Zu den Innovationen zählten der automatische Papiereinzug, der Randausgleich, Blocksatz, Fettdruck und das Löschen von Text.
Der Matritzendrucker
Bevor es moderne Kopierer gab, wurden die Aufgaben und Textdokumente in den Schulen in den 60er-Jahren mit einem Matrizendrucker (Spiritus- oder Blaudrucker) vervielfältigt. Dafür wurde die Matrize, die meist mithilfe einer Schreibmaschine von den Pädagogen erstellt wurde, in eine Walze eingespannt, die sich mit jeder Umdrehung die Farbe nahm, um ein neues Blatt zu bedrucken. Das Papier war immer leicht gelblich, mit einer unscharfen blauvioletten Farbe bedruckt und hatte diesen unverwechselbaren Lösungsmittelgeruch
Der Siebdruck
Der Siebdruck ist ein Druckverfahren, bei dem die Druckfarbe mit einer Gummirakel durch ein feinmaschiges Gewebe hindurch auf das zu bedruckende Material gedruckt wird. Das Verfahren benötigt zur Ausführung mehrere Schablonen. Das Porträt von Marilyn Monroe ist das bekannteste Kunstwerk des Pop-Art Künstlers Andy Warhol. Es wurde im Siebdruckverfahren erstellt. Am 22.02.2022 jährt sich sein Todestag zum 35 Mal.
1970 war das Jahr des ersten Tintendruckers
Der erste Tintenstrahldrucker war nur für industrielle Zwecke geeignet und wurde 1970 von der Firma IBM vorgestellt. Der Drucker arbeitete im Permanentbetrieb (continuous drop) und war nur für den Einsatz in der Industrie zu gebrauchen. Zum Endkunden kam erst der HP (Hewlett-Pakard) ThinkJet im Jahr 1984, als echter Endkundendrucker wird der HP Deskjet erst im Jahr 1988. Seine Druckgeschwindigkeit beträgt zwei Seiten pro Minute mit einer Grafikauflösung von 300 dpi. Aber schon 1887 brachte der HP PaintJet Farbe ins Büro. Es benötigte von der Erfindung des Tintenstrahldruckers bis zum ersten kommerziellen Laserdrucker, der 1976 auf den Markt kam, nur sechs Jahre. Der erste Laserdrucker, der IBM 3800, war ein riesiges Drucksystem für große Druckaufträge wie Kontoauszüge zum Beispiel. Der raumgroße Drucker erreichte eine Geschwindigkeit von 8580 Seiten pro Stunde, was eine Leistung von 755.000 Zeilen pro Stunde ergibt.
Nachdem um das Jahr 2000 die ersten Drucker erschienen waren, die mit Zusatzfarben wie Rot, Blau, Grün und Orange fotorealistische Ausdrücke in besserer Qualität als konventionelle Fotopapiere ermöglichten, begann die Ära der Foto-Drucker für die Papierformate DIN A3 und später auch für DIN A3.
Im Jahr 1987 brachte Charles W. Hull den weltweit ersten 3D Drucker auf den Markt, den SLA-1. Den Namen Drucker verdient das Gerät eigentlich nicht. Besser könnte er als Modellierungsmaschine bezeichnet werden, denn es werden beim Druckvorgang Materialien aufgebracht, die sowohl horizontal als auch vertikal angeordnet werden.
Der Matrixdrucker
Einige Druckerarten werden nur noch sehr speziell eingesetzt. Die sehr lauten Matrixdrucker stehen deshalb in allen Arztpraxen, weil Betäubungsmittelrezepte der Vorschrift nach in mehrfacher Ausfertigung ausgedruckt werden müssen und sie den Arzt wegen des verwendeten Kopierpapiers nur einmal unterschreiben muss.
Die Seiten- und die Zeilendrucker
Grundsätzlich kann zwischen zwei Druckertypen unterschieden werden.
Die erste Gruppe druckt eine Seite als ganze Einheit. Dazu zählen die Laserdrucker, LED-Drucker, Ionendrucker, die Thermotransfer-Drucker und andere Satzbelichtungsmaschinen. Um aber Seiten als ganze Einheit zu erstellen, benötigen diese Drucker einen großen Arbeitsspeicher. Zu den Zeilendruckern gehören die Typenraddrucker, die Nadeldrucker, einige Tintenstrahldrucker und die Thermodrucker, die vor allem in Lebensmittelgeschäften den Kassenbon ausdrucken.
Die Drucker von heute
Ob Tintenstrahldrucker, Laserdrucker oder welches Verfahren auch immer zum Einsatz kommt, die Geräte sind heute Multitalente. Drucker können Kopien anfertigen, scannen, viele auch faxen oder sich direkt ins Internet einloggen. Viele Drucker beherrschen den Farbdruck und auf Wunsch des Anwenders bedrucken sie auch die Rückseite des Blattes. Manche können auch direkt über eine App gesteuert werden, die sich auf einem Mobiltelefon befindet. Für nahezu jeden Anwender, ob privat, geschäftlich oder industriell genutzt, bietet der Markt die individuelle Drucklösung in Form von Multifunktionsdruckern an. Ebenfalls lässt sich heutzutage mobiles Drucken für unterwegs problemlos umsetzen.
Zum Schluss
Um aber die Geschichte des Druckens zu Ende zu erzählen, darf der Kartoffeldruck, der sich schon in den Kindergärten größter Beliebtheit erfreut, nicht unerwähnt bleiben. Dabei werden die Kartoffeln so zurechtgeschnitten, dass Stempelformen von Dreiecken oder Quadraten entstehen. In Farbe getaucht, können damit beeindruckende Rasterbilder erstellt werden. Und wer sich noch an seine Schulzeit erinnern kann, wird sich auch an den Kunstunterricht erinnern. Das Stück Linoleum für den Linoleumdruck wird biegsamer, wenn man es für kurze Zeit auf die Heizung legt.